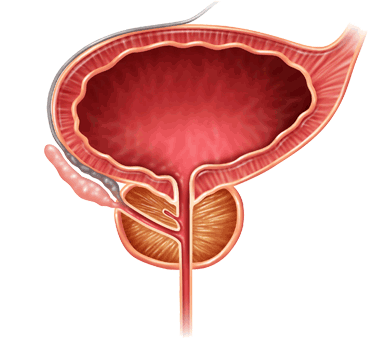
Die Harnblase ist ein Hohlmuskel mit spezialisierter Schleimhautauskleidung, welcher Urinmengen bis zu 1000 ml speichern kann.
Die Harnblase ist ein faszinierendes Organ, ein Hohlmuskel (Detrusor) mit spezialisierter Schleimhautauskleidung (Urothel), welches Urinmengen bis zu 500-1000 ml ohne nennenswerte Erhöhung des Binnendrucks speichern kann (Harnspeicherfunktion) und den gespeicherten Urin dann kontrolliert und vollständig (restharnfrei) entleeren kann (Blasenentleerungsfunktion). Störungen dieser Blasenfunktionen sind häufig und können die Lebensqualität stark beeinträchtigen.
Blasentumoren
Blasentumoren sind meist polypenartige Schleimhautwucherungen in der Harnblase. Sie machen sich häufig bemerkbar durch sichtbare Blutbeimengung im Urin, durch Reizblasenbeschwerden oder durch Blasenentzündungen, die trotz Antibiotikabehandlung nicht ausheilen. Auch ein mikroskopischer Blutnachweis im Urin (Mikrohämaturie) kann auf einen Blasentumor hindeuten. Raucher tragen ein deutlich höheres Risiko für Blasentumoren, ebenfalls Ex-Raucher und Passivraucher.
Die Mehrzahl der Blasentumoren wird aufgrund der oben genannten Anzeichen frühzeitig erkannt. Dieses ist für die weitere Behandlung sehr entscheidend. Der Urologe weist den Blasentumor durch einen Ultraschall und eine Blasenspiegelung nach.
Behandlung des Blasentumors
Die operative Entfernung des Blasentumors steht immer am Anfang der Behandlung. Dazu wird die Technik der transurethralen Resektion eingesetzt. Bei dieser Technik schneidet der Urologe den Tumor aus der Blasenwand mit speziellem Instrumentarium, welches über die Harnröhre in die Blase eingeführt wird. Nach Erhalt des feingeweblichen Gutachtens des Pathologen wird festgelegt, welche weiteren Behandlungsschritte unternommen werden müssen. Dieses kann entweder eine zweite gleichartige Operation nach drei bis vier Wochen zum tiefen Nachschneiden des Tumorgrundes sein oder eine lokale, d.h. über einen Katheter in die Blase verabreichte, Chemotherapie bzw. eine lokale Immuntherapie mit dem Tuberkuloseimpfstoff BCG.
Nachkontrolle des Blasentumors
Blasentumoren haben die Eigenschaft, oftmals an anderen Stellen der Blase – oder auch in der Schleimhaut des Harnleiters oder des Nierenbeckenkelchsystems – wieder aufzutreten. Daher ist die regelmässige Nachkontrolle mit Blasenspiegelung und Ultraschall durch den Urologen ausserordentlich wichtig.
Blasenentzündungen
Die Blasenentzündung, die akute Zystitis, ist bei Frauen häufig. Sie wird meist durch E. coli oder andere Darmbakterien ausgelöst. Besonders typisch tritt sie bei jungen, sexuell aktiven Frauen und bei Frauen in und nach den Wechseljahren auf. Meistens treten Beschwerden wie häufiger, schmerzhafter Harndrang und Brennen bei dem Urinieren auf. Der Urin ist meist trüb oder blutig verfärbt. Bei Männern sind Blasenentzündungen seltener und meist ein Anzeichen für eine sexuell übertragbare Infektion der Harnwege oder eine Prostataerkrankung. Ist eine Blasenentzündung ein Anzeichen für eine zugrundeliegende Erkrankung, handelt es ich nicht um eine einfache, sondern um eine komplizierte Blasenentzündung.
Behandlung der Blasenentzündung
Bei einer einfachen Blasenentzündung führt eine erhöhte Trinkmenge und eine kurze Antibiotikabehandlung in der Regel zu einer raschen Besserung und Ausheilung der Entzündung. Bei wiederkehrenden einfachen Blasenentzündungen werden zur Prophylaxe Preiselbeer- und Cranberrysäfte oder Immunstimulanzien eingesetzt. Bei komplizierten und fieberhaften Blasenentzündungen empfehle ich eine umfassende Abklärung des Harntrakts.
Interstitielle Zystitis
Die Interstitielle Zystitis ist eine bisher nur ungenügend erforschte und oft schwer zu diagnostizierende, chronisch verlaufende Blasenentzündung. Typisch ist bei der Interstitiellen Zystitis eine Störung der Harnspeicherfunktion mit Schmerzen bei der Blasenfüllung und verminderter Blasenkapazität. Oft wird diese Erkrankung jahrelang nicht richtig erkannt. Durch langjährige Assoziation mit dem Blasenzentrum Frauenfeld und wissenschaftlicher Betätigung zur molekularen Charakterisierung der Interstitiellen Zystitis habe ich auf diesem Gebiet besondere Erfahrung.


